Neue Dialysegeräte, die künstliche Niere, mehr Transplantationsmöglichkeiten – oder doch das ultimative Medikament gegen das Fortschreiten der chronischen Nierenkrankheit? Welche Entwicklungen werden die Nephrologie in den kommenden Jahren bestimmen, auf was dürfen Patienten hoffen? Wissenschaftler und Ärzte geben Antworten.

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Mobiltelefon? Bis Mitte der 1990er-Jahre hielten Handynutzer riesige „Knochen“ an ihr Ohr. Jahr für Jahr brachten die Hersteller dann im harten Wettbewerb immer kleinere Geräte auf den Markt, irgendwann waren sie wenig mehr als eine Streichholzschachtel groß und ließen sich auf- und zuklappen. Und dann, im Jahr 2007, gab es auf einmal etwas ganz Neues: das Smartphone, mit einem Touchscreen zum Wischen und nutzbar wie der Computer am Schreibtisch.
Forschung und technischer Fortschritt haben einen ganzen Markt und mit ihm das Leben der Menschen umgekrempelt. Auf eine ähnliche Entwicklung hofft für die 2020er-Jahre die Nephrologie – um die Zahl der weltweit Millionen von Menschen zu reduzieren, die jährlich an chronischem Nierenversagen sterben, und um die Situation der Dialysepatienten zu verbessern. Nach wie vor die gute Nachricht ist: Die Nephrologie ist das einzige Fach in der Medizin, das den Ausfall eines lebenswichtigen Organs, der Niere, über längere Zeit ausgleichen kann. Die Dialyse ist eine der großen Erfolgsgeschichten der Medizinwissenschaft.
Die Hoffnung auf ein längeres und leichteres Leben für nierenkranke Patienten ruht auf mehreren Füßen. Da wären beispielsweise kleinere Dialysegeräte und damit die Chance auf mehr Heimdialyse genauso wie mehr zur Verfügung stehende Spenderorgane oder gar die Chance auf die Xenotransplantation, die Einpflanzung von Tierorganen. Es gibt scheinbar weit fortgeschrittene Forschungen zur implantierbaren künstlichen Niere. Auch mit der Reproduktion im 3D-Drucker wird bereits experimentiert. Und schließlich gibt es die Hoffnung auf neue Arzneimittel. Denn noch liegen für akutes Versagen und chronische Funktionsstörungen der Niere keine Medikamente vor.
Neue Geräte, mehr Heimdialyse
Dr. Benno Kitsche ist ärztlicher Leiter des KfH-Nierenzentrums Köln-Merheim und Beauftragter des KfH zur Förderung und Weiterentwicklung der Heimdialyse. Er sagt, der technische Stand der heute genutzten Dialysemaschinen sei exzellent. „Im KfH haben wir die besten Dialysemaschinen zur Verfügung, die es gibt. Wir sind aber jetzt an einem Punkt, an dem die Geräte, die uns zur Verfügung stehen, nicht mehr großartig weiterentwickelt werden können. Wir mußten daher innehalten und uns die Frage stellen: Müssen wir Dialyse neu definieren?“
Bisher gehen die meisten Patienten dreimal die Woche für je rund vier Stunden ins Zentrum zur Dialyse. „Ich bin überzeugt, daß eine häufigere Frequenz die beste Dialyse wäre, die wir anbieten könnten“, sagt Kitsche. Den Weg dorthin könnten neue, kleinere Dialysegeräte ebnen. Kitsche berichtet: „Wir testen gerade mit einigen wenigen Patienten Geräte, die transportabel sind und das Dialysat selbst aufbereiten können. Sie ermöglichen den Patienten mehr Lebensqualität durch Unabhängigkeit von der täglichen Routine eines Nierenzentrums. Damit wird auch häufigeres Dialysieren leichter.“
Die geringe Größe des Gerätes eines US-Herstellers, der im Februar 2019 von einem deutschen Unternehmen übernommen wurde, bringt Patienten einen wichtigen Vorteil: Mobilität. Und die Handhabung für die Heimhämodialyse ist denkbar einfach. Kitsche erklärt: „Natürlich ist weiterhin das Punktieren Voraussetzung, aber die Schläuche müssen nicht mehr gelegt werden. Alles ist in einer Kassette. Klappe auf, Kassette rein, Klappe zu, den Filter anhängen und schon ist die Dialyse startklar.“
Kritische Punkte: Die Patienten müssen wegen der Slow-Motion-Technik etwas häufiger dialysieren und es entsteht mehr Müll, da die Kassette nach dem Dialysieren weggeworfen wird. Dagegen steht jedoch der geringe Wasserverbrauch. Durch die Slow-Motion-Technik benötigen diese Geräte nur rund 10 bis 20 Prozent der Wassermenge, die heute Dialysemaschinen üblicherweise verbrauchen. Kitsche rechnet vor: „In Deutschland dialysieren rund 90.000 Patienten dreimal wöchentlich und benötigen pro Dialyse im Schnitt 250 Liter. Wir brauchen dafür also mindestens 67.500.000 Liter Trinkwasser pro Woche!“ Die neuen Geräte leisten einen weiteren Beitrag zur Gesundheitsökologie: Sie können ihr Dialysat aus Leitungswasser herstellen.
Wasser ist für die Dialyse der Zukunft ein wichtiger Grundstoff, wie schon heute der Transport von Flüssigkeiten zu den Zentren und zu den Heimdialysepatienten von großer Bedeutung ist. „Wir transportieren immer noch sehr viele Flüssigkeiten zu unseren Patienten“, berichtet Klaus Staub, Leiter der Materialwirtschaft (Einkauf und Logistik). „Idealerweise werden die Flüssigkeiten künftig zunehmend dort entstehen, wo sie gebraucht werden. Bei vielen Zentren ist das heute schon der Fall. Wir liefern das Pulver, die Dialyseflüssigkeit wird vor Ort hergestellt. Das schont Ressourcen und hilft unserem Klima.“
Noch stehen einem breiten Einsatz von kleineren, wassersparenden Dialysegeräten ihre wesentlich höheren Kosten im Weg. Heimdialyseexperte Kitsche ist trotzdem überzeugt, daß sie der richtige Weg sind. „In Deutschland haben wir einen Anteil der Heimhämodialyse an den gesamten Dialyseverfahren von 0,8 Prozent, unsere Nachbarn, die Niederlande und Dänemark, liegen bei 6 Prozent, Neuseeland bei 18 bis 20 Prozent.“
Um Patienten eine möglichst hohe Lebensqualität zu erhalten, sollte seiner Ansicht nach die Heimdialyse verstärkt vorangetrieben werden. „Wir sind die Pioniere auf diesem Gebiet. Der Unterversorgung in Deutschland trat das KfH nämlich zunächst mit dem Ausbau der Heimdialyse entgegen. Da wir heute wissen, daß die Patienten durch eine häufigere und längere Behandlung gesünder und länger leben, haben wir daran wieder angeknüpft und fördern die Heimdialyse stärker.“
Hans-Holger Bleß ist geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für angewandte Versorgungsforschung (inav) in Berlin. Der Pharmazeut hat sich intensiv mit dem künftigen Versorgungsbedarf der Dialyse und speziell dem Potenzial der Heimdialyse beschäftigt und dazu Gutachten verfaßt. Bleß möchte aber den Präventionsgedanken in den Vordergrund rücken: „Es fängt ganz vorne an. Vor allem benötigen wir eine vernünftige Primärprävention. Wir haben bei den Nierenschäden zugrunde liegenden Erkrankungen, insbesondere bei Diabetes und Bluthochdruck, nach wie vor eine Zunahme und erhebliche Versorgungsdefizite. Die Verhinderung der Erkrankung wäre ein ganz wesentlicher Ansatz.“
Das hat auch die Weltgesundheitsorganisation WHO erkannt und kürzlich in ihre Zielverordnung aufgenommen. Läßt sich die Dialysepflicht nicht umgehen, sprechen viele Vorteile für die Heimdialyse, die als Peritoneal- oder Hämodialyse durchgeführt werden kann. Sie unterstützen könnte auch der Prozeß der Digitalisierung mit neuen Möglichkeiten wie beispielsweise der Video-Sprechstunde. Verfahren der Telemedizin „werden grundsätzlich kommen“, sagt Bleß, und er kann sich dies auch für das Heimdialyseverfahren vorstellen.
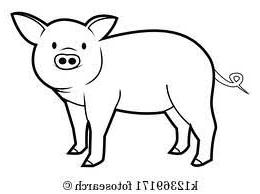
Xenotransplantation und Kunstniere
Neben dem Blick auf strukturelles Veränderungspotenzial wird die Zukunft der Nephrologie vor allem von der Wissenschaft gemacht. Für Aufsehen sorgte im August die Meldung, wonach japanische Forscher menschliche Zellen in Tierembryonen einpflanzen. So könnten irgendwann einmal auf den Menschen übertragbare Organe gewonnen werden.
Schon seit langer Zeit kursiert die Idee, Tiere als Ersatzteillager für Menschen zu nutzen. Forscher suchen nach Wegen, tierische Organe durch Genveränderungen so weit zu verändern, daß sie transplantiert werden können. Beispielsweise planen Wissenschaftler in den USA, genmodifizierte Schweinenieren schwer kranken Dialysepatienten zu verpflanzen. Es wird berichtet, daß Affen in Pilotversuchen damit fast ein Jahr lang überlebten. Momentan gelingt es noch nicht, mit den zur Verfügung stehenden Immunsuppressiva die hyperakute Abstoßung eines dem Menschen fremden („xeno“) Transplantats dauerhaft zu unterdrücken.
Vielleicht liegt da die implantierbare Kunstniere doch näher? Diesen Weg haben US-Wissenschaftler an der University of California in San Francisco eingeschlagen. Im kaffeebechergroßen Gerät, welches die Gruppe „The Kidney Project“ entwickelt hat, arbeiten laut deren Angaben zwei Module zusammen: „Ein Hämofilter reinigt das ankommende Blut zu einem wäßrigen Ultrafiltrat, das gelöste Toxine sowie Zucker und Salze enthält. Zweitens verarbeitet ein Bioreaktor von Nierenzellen das Ultrafiltrat und schickt die Zucker und Salze zurück ins Blut. Dabei wird auch Wasser wieder in den Körper aufgenommen und das Ultrafiltrat in ‚Urin‘ konzentriert, der zur Ausscheidung in die Blase geleitet wird.“
Der Prototyp des Hämofilters auf Mikrochip-Basis sei bereits bis zur Dauer von einem Monat „ohne ernsthafte Komplikationen“ an Tieren getestet worden.
Die sehr werblich gehaltene Darstellung sollte indes mit der nötigen Distanz betrachtet werden, das sieht auch Florian Schmieder so. Er ist Experte für mikrophysiologische Systeme und forscht am Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) in Dresden. Eine funktionierende Implantation des in San Francisco entwickelten Geräts kann sich Schmieder nicht vorstellen. Zudem sei kein wesentlicher Fortschritt gegenüber der herkömmlichen Dialyse zu erkennen. Weder die Hormonbildung noch die Steuerung des Blutdrucks könne eine solche künstliche Niere bieten. Von Vorteil wäre nur die permanente Dialysefunktion.
Dennoch ist die Vision der künstlichen Niere womöglich gar nicht so weit weg. Schmieder und Kollegen arbeiten am Fraunhofer-Institut mit Zellkulturen in Visitenkartengröße, die Funktionsmechanismen der menschlichen Organe nachbilden. Im Prinzip enthalten die künstlichen mikrophysiologischen Systeme all das, was man im menschlichen Körper findet: Blutgefäße, Blut, verschiedene Zelltypen, Zellträger, Speicherreservoire, Pumpsysteme – nur eben als technische Bauteile. Die eingebrachten Zellkulturen ahmen die Organe oder Organteile nach, während im Gefäßnetz blutähnliche Flüssigkeiten zirkulieren, angetrieben von einer Minipumpe.
Nierenzellen auf einem Chip können genutzt werden, um ohne Tierversuche Medikamente zu testen und Krankheitsprozesse der Niere nachzustellen. Recht bald, schätzt Schmieder, werden die Ergebnisse helfen, patientenspezifische Therapien zu optimieren. Zum anderen forschen die Dresdner Wissenschaftler in Richtung Organersatz: Sie ahmen eine Embryogenese nach, lassen sozusagen eine kleine Niere nachwachsen. „Von der Größe her sind wir bei einem Vierzehntausendstel einer ausgewachsenen Niere“, erläutert Schmieder.
Das tragbare Dialysegerät

In der wissenschaftlichen Entwicklung schon weiter vorangeschritten ist das tragbare Dialysegerät, etwa in einer Weste oder als Rucksack. Daran arbeiten Forscher zum Beispiel in den USA, in Italien und auch in Deutschland. Herausforderungen dabei: Der Gefäßzugang beim Patienten muß sicher sein, und es muß Dialysewasser gespart werden. Während für eine konventionelle Blutwäsche im Schnitt 250 Liter Waschlösung benötigt werden, muß ein tragbares Gerät mit viel weniger auskommen. An der Minimierung des Wasserverbrauchs forscht eine Projektgruppe des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI) und der Uniklinik Rostock.
Physiker Dr. Rainer Goldau tüftelt derzeit an einer verblüffenden Lösung: Als Filter wird Eis genutzt. Goldau hat die Wasserversorgung der Dialyse so konzipiert, daß dafür Wasser verwendet wird, das dem Patienten zuvor im Rahmen der Dialyse entzogen wurde. Das Wasser kann der Patient in einer Weste zusammen mit einem Mini-Dialysator direkt am Körper oder in einem kleinen Rucksack bei sich tragen. Zur Reinigung des Wassers verbindet der Patient die Weste alle paar Stunden mit einer Basisstation, die nach dem Prinzip der Kryoreinigung funktioniert: Wasser befreit sich beim Gefrieren selbst von Abfallstoffen und Giften. Denn in entstehenden Eiskristallen werden keine Fremdmoleküle eingebaut, auch kein Harnstoff. „Alle fremden Stoffe werden im Moment des Gefrierens auf der Oberfläche und in den Zwischenräumen der Eiskristalle gelagert“, erläutert Goldau. Gelingt es, die Eiskristalle vor dem Auftauen schonend zu waschen, ist das Wasser von seiner gesamten Verunreinigung getrennt. Wir kennen diesen Effekt: Nach dem Aussaugen des „Geschmacks“ bei einem Wassereis bleibt das pure Eis zurück.

Im Grunde, so erklärt Goldau, handelt es sich um das Gegenteil eines Verfahrens in der Getränkeindustrie, wo beispielsweise Fruchtsaft vor dem Transport das Wasser entzogen wird. „Da verwirft man das Wasser und verschickt das Konzentrat. Das Konzentrat ist bei dem Verfahren, das ich mir Schneemann-Vektor-Bild überlegt habe, das Äquivalent des Urins. Wir verwerfen den Urin und benutzen das Wasser, das übrig bleibt, für die nächste Waschrunde in einem Kreislauf.“ Labormessungen zufolge ist die Reinigungskraft des Eises enorm. „Wir schaffen es, den Harnstoff und alle weiteren 130 Giftstoffe des Blutes in ungefähr fünf bis zehn Prozent des Wassers zu konzentrieren und 90 bis 95 Prozent sauberes Wasser zu erhalten. Die geringe Menge an Wasser, die verworfen wird, entspricht mehr oder weniger dem, was die Patienten an Wasser ohnehin verlieren müßten.“
Noch, sagt Wissenschaftler Goldau, befinde sich dieses Verfahren in einer frühen Entwicklungsphase, Experimente stimmen die Forscher aber zuversichtlich. Der Verzicht auf eine zusätzliche Wasserinstallation könnte Heim- wie Zentrumspatienten zu ungeahnter Mobilität verhelfen und Kosten senken. Und das nur, weil ein einfaches Naturgesetz nutzbar gemacht wird.
Kommen neue Medikamente?
Besser als jede verbesserte Dialyse oder mehr Transplantationsoptionen ist die Prävention einer chronischen Nierenerkrankung oder die Entwicklung von Medikamenten dagegen. Der Hoffnun g Auftrieb gaben im vergangenen Frühjahr beim Welt-Nierenkongreß in Melbourne vorgestellte Studiendaten: Danach konnte bei Diabetikern das Fortschreiten der chronischen Nierenkrankheit mit dem Arzneistoff Canagliflozin verlangsamt werden. Prof. Dr. Jan C. Galle, Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie (DGfN), sagt: „Seit Jahrzehnten trat die Forschung auf der Stelle und verschiedene Substanzen, mit denen man die Progredienz der chronischen Nierenkrankheit aufzuhalten hoffte, versagten spätestens in der dritten Phase der klinischen Prüfung und erwiesen sich als unwirksam oder gar gefährlich.“
Nun stelle das Ergebnis der internationalen Studie „einen echten Durchbruch“ dar: Das relative Risiko, den renalen Studienendpunkt, bestehend aus Erreichen der Dialysepflichtigkeit, Verdopplung des Serum-Kreatinins oder dem renalen Tod, bei den untersuchten Patienten zu erreichen, konnte durch das Medikament um etwa ein Drittel reduziert werden. Auch das Risiko, an Herz- oder Gefäßerkrankungen zu versterben, war bei den mit Canagliflozin behandelten Patienten hochsignifikant geringer.
Schon vorher gab es Erkenntnisse, daß die sogenannten SGLT2-Hemmer, in diesem Fall Empagliflozin, entsprechend wirken. „Die SGLT2-Inhibitoren sind eine wesentliche Entwicklung“, bestätigt der Nephrologe und Wissenschaftler Prof. Dr. Thomas Benzing. „Natürlich kann man die Dialysemaschinen verbessern, aber das primäre Ziel muß sein, Dialysetherapie zu verhindern.“
Die große Zukunftsfrage der Nephrologie ist: Welche der geschilderten Entwicklungen schafft wann den Durchbruch respektive eine „Serienreife“, um die Leiden nierenkranker Patienten zu lindern, das Fortschreiten der Krankheit zu stoppen oder ihre Nieren wie selbstverständlich zu ersetzen? Was wird das Smartphone der Nephrologie? Vielversprechende Ansätze gibt es.
aus: KfH aspekte 3-19, auch Fotos